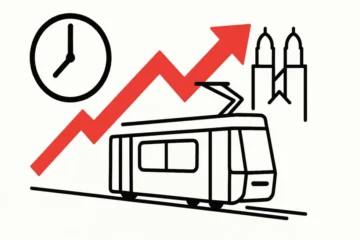Seit Jahren arbeitet der rot-grün dominierte Zürcher Stadtrat an einem umfassenden Konzept zur Umgestaltung des Hauptbahnhofs und seiner Umgebung. Nun hat die Stadt ein sogenanntes «Weissbuch» veröffentlicht, das als strategische Grundlage für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dient. Darin wird ein massiver Umbau angekündigt, bei dem der Autoverkehr im Herzen der Stadt praktisch vollständig verschwinden soll. Darüber berichtet nume.ch unter Berufung auf nzz.ch.
Im Zentrum der Planungen steht die Umwandlung des gesamten Bahnhofplatzes, der Bahnhofbrücke sowie der Museumstrasse zwischen Hauptbahnhof und Landesmuseum in autofreie Zonen. Taxis dürfen in bestimmten Bereichen weiterhin zufahren, doch für den motorisierten Individualverkehr sind diese Achsen künftig tabu. Auch die Strassen Richtung Central – darunter der Seilergraben und der Limmatquai – sollen für Autos gesperrt und neu gestaltet werden. Damit will die Stadt die Aufenthaltsqualität im gesamten Quartier deutlich erhöhen.
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Bahnhofbrücke: Sie soll zu einer grossen, zentralen Tramhaltestelle umgebaut werden. Gleichzeitig wird die Löwenstrasse vom Tramverkehr entlastet – künftig fahren die Trams stattdessen über den Europaplatz zum Hauptbahnhof. Der Bahnhofquai-Tunnel, durch den heute schon Autos geführt werden, soll verlängert werden. An der Oberfläche entsteht nach den Vorstellungen der Stadt eine neue Grünzone, die für Fussgänger und Velofahrer nutzbar ist.
Die Begründung für diese weitreichenden Massnahmen liefert die Stadt gleich mit: Das Hochschulgebiet wächst, immer mehr Menschen bewegen sich im Umfeld des Bahnhofs, und die heutige Mobilitätsinfrastruktur sei unzureichend. Fussgänger hätten zu wenig Platz, für Velos gebe es keine durchgehenden sicheren Verbindungen, und im Sommer erhitze sich das Gebiet stark. Das Weissbuch spricht deshalb von einem erheblichen Defizit, das durch einen Paradigmenwechsel im Stadtverkehr behoben werden müsse.
Der Hauptbahnhof soll künftig als «grüne Spitze» fungieren – eine zusammenhängende Grünanlage, die von der Gessnerbrücke über den Platzspitz entlang der Limmat bis hin zum Globus-Provisorium reicht. Der Bahnhofplatz soll zudem seine historische Funktion als repräsentativer Platz zurückerhalten. Das Central wird zu einem grosszügigen Platz umgestaltet und damit zum Tor in das Hochschulquartier und ins Niederdorf. Die Löwenstrasse wiederum soll ohne Tram zu einer reinen Einkaufs- und Flaniermeile werden.
Das Weissbuch selbst ist noch kein Bauprojekt, sondern bildet den Rahmen für mittel- und langfristige Massnahmen. Die Umsetzung soll Schritt für Schritt erfolgen und wird voraussichtlich über Jahre andauern. Allerdings macht die Stadt bereits deutlich, dass man an den ehrgeizigen Zielen festhält. Für Fussgängerinnen und Fussgänger soll der zentrale Stadtraum durchlässig, sicher und komfortabel gestaltet werden. Velofahrer sollen den Bahnhof aus allen Richtungen direkt erreichen können.
Gleichzeitig räumt die Stadt ein, dass die Pläne «vertieft evaluiert» werden müssten. Unklar sei etwa, ob die Zahl der Tramgleise tatsächlich von vier auf zwei reduziert wird. Schon im vergangenen Jahr, als erste Details bekannt wurden, hatte der ehemalige VBZ-Direktor Guido Schoch vor chaotischen Zuständen im öffentlichen Verkehr gewarnt, sollte die Infrastruktur zu stark eingeschränkt werden. Die Stadt betont zwar, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen sei, doch das Ziel bleibe eine Entlastung zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs.
Auch die Frage nach der Bewältigung des Autoverkehrs steht im Fokus. Laut Weissbuch macht Transitverkehr rund 20 Prozent der Bewegungen aus und soll konsequent auf die Autobahnen verlagert werden. Weitere 20 Prozent entfallen auf Fahrten von ausserhalb in die Stadt, die «möglichst lange» auf dem Autobahnring gehalten werden sollen. 40 Prozent betreffen reinen städtischen Binnenverkehr – etwa von Wollishofen nach Schwamendingen. Dieser Anteil soll künftig stärker durch Velo und öffentlichen Verkehr übernommen werden. Der verbleibende Rest von 20 Prozent betrifft Anlieferungs- und Erschliessungsverkehr, der in der Innenstadt verbleibt.
Damit diese Verlagerungen gelingen, setzt die Stadt auf den Ausbau der Nordumfahrung sowie die Kanalisierung des Verkehrs auf die Achse Hardbrücke–Rosengartenstrasse. Der dortige Verkehr soll wiederum durch die Autobahn entlastet werden. Ob die Pläne auch Auswirkungen über die Stadtgrenzen hinaus haben, ist noch offen. Laut der Kantonsverfassung darf eine neue Signalisation ausserhalb der Stadt die Kapazität nicht einschränken – ein potenzielles Konfliktfeld zwischen Stadt und Kanton.
Neben den technischen und rechtlichen Fragen gibt es auch deutliche Kritik aus der Wirtschaft. Die City-Vereinigung, der Verband des innerstädtischen Gewerbes, befürchtet massive Nachteile für Geschäfte und Kunden. Geschäftsführer Dominique Zygmont warnte vor einer Verschlechterung der Mobilität an zentralen Knotenpunkten und längeren Umsteigezeiten im ÖV. Einzelne Verbesserungen am Bahnhofplatz seien zwar sinnvoll, doch im Ganzen stünden die Kosten und der Nutzen in keinem ausgewogenen Verhältnis. Zudem drohe mit den Projekten eine jahrelange Grossbaustelle im Herzen Zürichs – eine Belastung, die das Gewerbe nach eigenen Angaben nicht verkraften könne. «Das Gewerbe erträgt keine weitere Mega-Baustelle im Herzen Zürichs», sagte Zygmont und forderte die Stadt zu einem «Marschhalt» auf.
Angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse in Zürich ist es allerdings unwahrscheinlich, dass dieser Ruf nach einem Stopp die Pläne entscheidend beeinflusst. Der Stadtrat hat mit dem Weissbuch klar signalisiert, dass er die Umgestaltung des Hauptbahnhofs entschlossen vorantreibt – auch wenn viele Fragen noch offen sind.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht: Politische Stabilität in der Schweiz: Wie das Kantonsystem im Jahr 2025 funktioniert
Foto von Brunecky