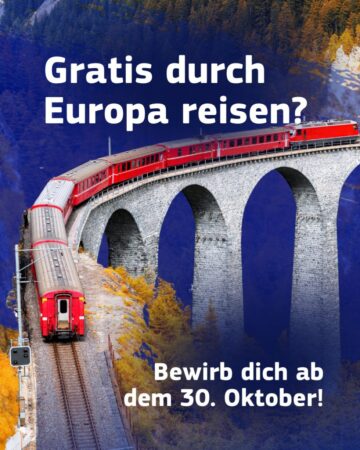Die Schweizer Autorin Gertrud Leutenegger ist im Alter von 76 Jahren in ihrem Geburtsort Schwyz verstorben, berichtet NUME.ch. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme, einer Prosa zwischen Licht und Nebel, Traum und Schmerz, gehörte sie zu den bedeutendsten, aber auch eigenwilligsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
Wer ihr Werk liest, muss bereit sein, sich zu verlieren – in Satzlandschaften ohne festes Ziel, in Gedankenschlaufen, die nicht erklären, sondern öffnen. Ihre Literatur war eine Form des Widerstands gegen das Eindeutige, gegen das Glatte und Fertige.
Eine Autorin jenseits des Mainstreams
Gertrud Leutenegger, geboren 1948 in Schwyz, wuchs in einem katholisch-konservativen Milieu auf. Früh zog es sie in die Welt: nach Florenz, Paris, Japan, Berlin – und immer wieder nach Zürich, wo sie zuletzt lebte. Doch die Landschaften der Innerschweiz, die Seen, die Berge, das flackernde Licht über den Alpen – sie blieben in ihren Texten stets gegenwärtig.
Bereits ihr Debüt Vorabend (1975) signalisierte einen literarischen Aufbruch. Eine Frau wandert in der Nacht vor einer 68er-Demonstration durch Zürich – doch es geht nicht um Politik, sondern um Erinnerung, Kindheit, innere Stimmen. Leutenegger dekonstruiert Zeit und Raum, löst Handlung in Sprachmusik auf. Schon hier zeigt sich, wofür sie später berühmt wurde: das assoziative Ineinanderfließen von Zeit- und Bedeutungsebenen, der Verzicht auf einen erzähltechnischen „Plot“, die radikale Subjektivität.
Zwischen Stille und Strom – das Werk
Gertrud Leutenegger schrieb Lyrik, Prosa, Essays, Theaterstücke. Doch immer ging es um dasselbe: den Versuch, durch Sprache die Welt transparent zu machen – nicht als Abbild, sondern als Spiegel innerer Zustände. Ihre Bücher sind keine Antworten, sondern Atmosphären. Sie verstand sich nicht als Geschichtenerzählerin, sondern als Sprachkomponistin, die Erinnerungsräume, Seelenräume, Naturerfahrungen in Textform gießt.
Wichtige Werke
| Jahr | Titel | Besonderheit |
|---|---|---|
| 1975 | Vorabend | Literarisches Debüt, zentrales Werk der feministischen Prosa der 70er |
| 1982 | Ninive | Mystisch-poetischer Text über Zerstörung und Neuanfang |
| 1999 | Kontinent | Essayistische Reflexion über Grenzen, Zeit und Topographie |
| 2014 | Panischer Frühling | Nominiert für den Deutschen und Schweizer Buchpreis – ein Höhepunkt |
| 2020 | Späte Gäste | Flüchtlingsgeschichte, Erinnerungsmonolog, eine Elegie auf das Ankommen |
In Panischer Frühling, einem ihrer bekanntesten Romane, wandelt eine Frau durch das London des Jahres 2010, gelähmt vom Vulkanausbruch in Island. In dieser Sprachlandschaft verdichtet sich alles, wofür Leutenegger stand: Reflexion, Einsamkeit, Natur und Innerlichkeit. Die Welt ist zum Stillstand gekommen – ein idealer Resonanzraum für Erinnerungen und Projektionen.
Das Ich, das sich auflöst
Obwohl sie oft aus der Ich-Perspektive schrieb, war sie keine Autorin autobiografischer Literatur. Im Gegenteil: Sie betonte stets, dass sie „aus dem Ich heraus schreibe, um sich selbst zu verlassen“. Es ging ihr nicht ums persönliche Bekenntnis, sondern um eine poetische Haltung, die den Menschen als Teil eines größeren, oft rätselhaften Zusammenhangs versteht.
„Mit einem einzigen Bild der Wirklichkeit kann niemand leben“, sagte sie einmal. Ihr Schreiben wollte Schichten übereinanderlegen, Zwischenräume schaffen – dort, wo Bedeutungen vibrieren, aber nicht fixiert sind.
Literaturpreise statt Bestsellerlisten
Gertrud Leutenegger war keine Autorin für den Massengeschmack. Sie scheute das öffentliche Rampenlicht, gab kaum Interviews, trat selten auf. Und dennoch wurde sie vielfach ausgezeichnet:
- Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank
- Solothurner Literaturpreis 2023
- Kunstpreis der Stadt Zürich 2024
- Nominiert für den Deutschen Buchpreis (Panischer Frühling)
- Nominiert für den Schweizer Buchpreis
Diese Preise würdigten nicht nur ihr literarisches Werk, sondern auch eine künstlerische Haltung, die sich nie von Trends, Debatten oder Erwartungen leiten ließ.
Das Gesicht der Stille
Wer Gertrud Leutenegger begegnete, sah eine Frau mit wachen, jungen Augen, schulterlangem grauen Haar und roten Lippen. In Gesprächen war sie klug, heiter, wach – aber nie laut. Ihre Stärke lag in der Konzentration, im genauen Denken, im freien Spiel der Vorstellung.
Sie unterschrieb keine Petitionen, schrieb keine politischen Kommentare. Meinung sei „etwas Fertiges“, sagte sie. Ihre Texte waren das Gegenteil: offen, porös, mehrschichtig. Ihre Literatur war ein geistiger Raum für Ambivalenz, Fragilität und Trost.
Gertrud Leutenegger starb am Freitag in Schwyz. Sie hinterlässt eine Tochter – und ein literarisches Werk, das kein lauter Nachruf je fassen kann. Ihre Bücher werden nicht gelesen, um schnell verstanden zu werden, sondern um etwas in uns zum Klingen zu bringen, das sonst im Lärm der Zeit verloren geht.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht: Horgen nimmt Abschied: Staatstrauer für Vreni Spoerry in der reformierten Kirche
Foto: picture alliance / dpa