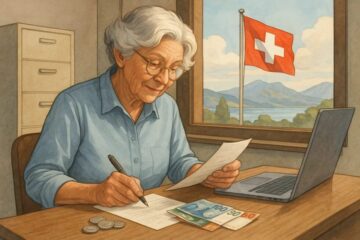Die Sicherheitslage der Schweiz hat sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die globalen Machtkonflikte und den Angriffskrieg in der Ukraine, fundamental verschlechtert. Gemäß dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist die neutrale Schweiz längst kein unbeteiligter Beobachter mehr, sondern ein direkt betroffenes strategisches Ziel. Die gleichzeitige Intensivierung von Spionageaktivitäten, gezielten Cyberangriffen und Proliferationsversuchen stellt das Land vor beispiellose Herausforderungen. Angesichts dieser Bedrohungsdichte – die höchste seit dem Ende des Kalten Krieges – sieht sich der Bundesrat gezwungen, seine sicherheits- und rüstungspolitischen Strategien grundlegend neu auszurichten. Die Schweiz wird somit zum Schauplatz hybrider Konflikte, in denen das Know-how ihrer Technologieunternehmen und die Stabilität ihrer Infrastrukturen im Zentrum der Aufmerksamkeit ausländischer Akteure stehen, der Redaktion von nume.ch.
Die neue Dimension der Bedrohung: Spionage und Sanktionsumgehung
Die globale Konfrontation zwischen den westlichen Mächten auf der einen Seite und revisionistischen Staaten wie Russland und China auf der anderen Seite hat direkte Auswirkungen auf die Schweiz. Durch ihren Status als wichtiger Standort für Hochtechnologie, Forschungseinrichtungen und internationale Organisationen gerät die Schweiz zunehmend ins Visier fremder Nachrichtendienste. Die Spionagebedrohung wird vom NDB als anhaltend hoch eingestuft, wobei Russland und China die größte nachrichtendienstliche Präsenz im Land unterhalten. Diese Akteure interessieren sich nicht nur für bundesrätliche Geheimnisse, sondern verstärkt für Schlüsseltechnologien und Dual-Use-Güter, die zur Umgehung internationaler Sanktionen dienen.

Russlands und Chinas Aktivitäten: Das strategische Ziel Schweiz
Die traditionelle Spionage, bei der sich Agenten als Diplomaten oder Geschäftsleute tarnen, wird durch die Cyberspionage in nie dagewesenem Ausmaß ergänzt. Die Schweiz dient als Drehscheibe für Proliferations- und Sanktionsumgehungsversuche, insbesondere durch Staaten wie Russland, Iran und Nordkorea. Diese versuchen, über Schweizer Firmen und Netzwerke kritische Güter und Technologien für ihre militärischen und nuklearen Programme zu beschaffen. Der NDB arbeitet intensiv mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zusammen, um diese illegalen Beschaffungsaktivitäten aufzudecken und zu unterbinden, was die Schweiz in einen aktiven Part des globalen Wirtschaftskriegs zwingt. Die Erkenntnisse des NDB zeigen klar, dass die wirtschaftliche und technologische Souveränität des Landes direkt bedroht ist.
- Russland und China unterhalten die stärkste nachrichtendienstliche Präsenz in der Schweiz.
- Das Hauptinteresse gilt Schlüsseltechnologien, der Rüstungsindustrie und Forschungseinrichtungen.
- Die Schweiz wird als Drehscheibe zur Umgehung internationaler Sanktionen genutzt.
- Proliferationsversuche betreffen die Beschaffung von Dual-Use-Gütern für militärische Zwecke.
- Der NDB tauschte 2024 über 18.000 Meldungen mit ausländischen Partnerdiensten aus, was die Intensität belegt.
Die verschärfte Konkurrenzsituation zwischen den Großmächten macht die Schweiz zu einem bevorzugten Operationsgebiet. Die neutrale Position des Landes wird von fremden Diensten bewusst ausgenutzt, um hier ungestört agieren und Informationen sammeln zu können. Diese hybride Kriegsführung unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts erfordert eine grundlegende Anpassung der Verteidigungsstrategien der Schweiz
Cyberangriffe: Die digitale Achillesferse der Schweiz
Neben der klassischen Spionage hat sich die Bedrohung durch Cyberangriffe zu einem der akutesten Risiken für die Schweiz entwickelt. Die digitale Angriffsfläche wächst exponentiell, angetrieben durch die zunehmende Vernetzung und die Verbreitung von künstlicher Intelligenz, die zur Automatisierung und Verfeinerung von Angriffswerkzeugen genutzt wird. Die Statistik des Bundesamtes für Cybersicherheit (OFCS) belegt diese Entwicklung eindrücklich: Alle achteinhalb Minuten wird ein Cybervorfall gemeldet. Im Fokus stehen nicht nur Unternehmen, sondern zunehmend kritische Infrastrukturen wie Energieversorger, Telekommunikationsfirmen und das Gesundheitswesen, deren Ausfall die gesamte Funktionsfähigkeit des Staates gefährden würde. Staatlich geförderte Cyber-Akteure aus Russland und China führen gezielte Spionageoperationen gegen politische Behörden und Technologieunternehmen durch, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen.
Kritische Infrastrukturen im Visier: Ransomware und Sabotage
Die Angriffe auf kritische Infrastrukturen stellen eine bedeutende Bedrohung dar, obwohl gezielte Cyber-Sabotage durch staatliche Akteure in der Schweiz bislang nur selten beobachtet wurde. Der NDB warnt jedoch, dass Angriffe aus machtpolitischem Kalkül erfolgen könnten, um entweder die Schweiz direkt zu destabilisieren oder Nachbarstaaten als NATO- oder EU-Mitglieder indirekt zu schaden. Neben staatlicher Spionage ist die opportunistische Cyberkriminalität, insbesondere Ransomware-Angriffe, eine massive finanzielle Bedrohung für Schweizer Unternehmen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ermöglicht es kriminellen Akteuren, Angriffe raffinierter, zielgerichteter und in großem Umfang automatisiert durchzuführen, wobei Zero-Day-Schwachstellen in Netzwerkgeräten häufig ausgenutzt werden.
| Angriffsart | Betroffene Sektoren (Fokus 2025) | Hauptakteure |
| Cyberspionage | Rüstung, Technologie, Forschung | Russland, China |
| Sanktionsumgehung | Dual-Use-Güter, Finanzwesen | Russland, Iran, Nordkorea |
| Terrorbedrohung | Online-Radikalisierung Jugendlicher | Dschihadismus |
| Cyberkriminalität | KMU, Gesundheitswesen (Ransomware) | Kriminelle Gruppen weltweit |
Die Zahlen aus dem ersten Quartal 2025 zeigen einen starken Anstieg der Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen, teilweise stärker als im weltweiten Durchschnitt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Cyber-Resilienz des Landes massiv zu erhöhen. Das Risiko, indirekt Opfer eines Angriffs auf internationale Partner zu werden, stuft der NDB für kritische Infrastrukturen als erhöht ein.
Die Strategische Antwort des Bundesrates: Neuausrichtung und Verteidigung
Angesichts der verschlechterten Sicherheitslage hat der Bundesrat eine umfassende Neuausrichtung seiner Sicherheitspolitik eingeleitet. Er reagiert damit auf das erhöhte Bedürfnis nach strategischen Leitlinien, die das Land in die Lage versetzen sollen, Risiken möglichst frühzeitig und über die Landesgrenzen hinaus zu begegnen. Eine der zentralen Neuerungen ist die Erarbeitung der ersten übergreifenden Sicherheitspolitischen Strategie (Sipol S 25), die als Dachstrategie für alle weiteren verteidigungspolitischen Maßnahmen dienen soll. Diese Strategie strebt eine Zweikomponentenstrategie an: einen bewahrenden, defensiven Schwerpunkt zur Abwehr feindlicher Handlungen und einen ausgreifenden, aktiven Schwerpunkt zur Gestaltung und Sicherung des sicherheitspolitischen Umfelds.
Neue Rüstungspolitik und Stärkung der Verteidigungsfähigkeit
Parallel zur Sicherheitsstrategie hat der Bundesrat seine Rüstungspolitische Strategie verabschiedet, die auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Armee abzielt. Dies umfasst die Sicherstellung einer zeitgerechten Versorgung der Armee mit Bewaffnung, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie die Stärkung der Durchhaltefähigkeit und der internationalen Kooperationsfähigkeit. Die Schweiz bleibt zwar bei den Hauptsystemen von Rüstungsgütern aus dem Ausland abhängig, setzt aber auf die Förderung einer verteidigungskritischen Industriebasis im Inland, um die Resilienz im Kriegsfall zu stärken. Eine intensive Zusammenarbeit mit Nachbarländern, der NATO und der EU wird als strategische Notwendigkeit betrachtet, um den Zugriff auf moderne Verteidigungstechnologien und Frühwarnsysteme zu sichern.
Zusätzlich zu diesen militärischen und rüstungspolitischen Maßnahmen konzentriert sich der Bundesrat in der "Strategie Digitale Schweiz 2025" auf die Stärkung der Informations- und Cybersicherheit. Die Fokusthemen für 2025 umfassen die Regulierung der Künstlichen Intelligenz zur Wahrung von Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit sowie die Etablierung neuer, robuster Strukturen im Bereich Cyber- und Informationssicherheit, die auch den kantonalen und kommunalen Verwaltungen zugutekommen sollen.
Die Sicherheitslage der Schweiz im Jahr 2025 ist durch eine beispiellose Dichte hybrider Bedrohungen gekennzeichnet, die von staatlicher Spionage bis hin zu organisierten Cyberangriffen reichen. Die grössten Gefahren gehen vom Konflikt zwischen den Grossmächten aus, wobei Russland und China die prominentesten Spionage-Akteure sind. Der Bundesrat reagiert auf diese Realität mit einer grundlegenden strategischen Neuausrichtung, welche die militärische Verteidigungsfähigkeit stärkt und eine intensive internationale Kooperation sucht. Die Schweiz muss ihre Cyber-Resilienz massiv erhöhen, um die kritischen Infrastrukturen zu schützen und ihre Neutralität in einer zunehmend konfrontativen Welt zu behaupten.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht – in der Schweiz und der Welt: Schweiz verschärft Schutzstatus S für Ukrainer – differenzierte Regelung ab November.