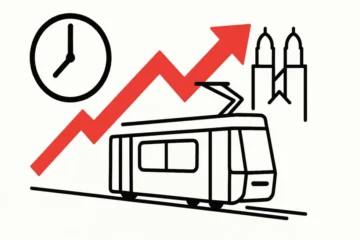Der Stadtzürcher Schulvorsteher Filippo Leutenegger, der in Kürze in den Ruhestand tritt, blickt auf viele Jahre im Amt zurück. Im Frühling 2025 wird der 73-jährige FDP-Politiker nach seinem letzten ersten Schultag als Schulvorsteher von der politischen Bühne abtreten. In einem ausführlichen Gespräch äußert sich Leutenegger zu wichtigen Themen wie Schulwegen, dem Umgang mit der politisch gefärbten Schulpolitik und zu der oft kontrovers diskutierten Frage nach dem besten Bildungsweg: Sekundarschule oder Gymnasium? Darüber berichtet nume.ch unter Berufung auf nzz.
Leutenegger, der in Rom aufgewachsen ist, erinnert sich an seinen ersten Schulweg: „Wir wohnten auf der anderen Seite der Stadt, und ich musste täglich eine Stunde im Schulbus zur Schule fahren und wieder zurück“, erzählt er. „Rom in den 1960er Jahren war voll von Autos und überfüllt mit Cinquecentos. Überall Staus – das bleibt mir noch gut in Erinnerung.“ Der Stadtzürcher Schulvorsteher schätzt besonders die Möglichkeit, dass Kinder in Zürich oft den Schulweg zu Fuß gehen können. „Es ist eine Errungenschaft, die wir verteidigen müssen“, so Leutenegger. Im Vergleich zu seiner eigenen Schulzeit in Rom, in der die Mahlzeiten einfach und spärlich waren, lobt er die heute verfügbaren, abwechslungsreichen Mittagsangebote in den Zürcher Tagesschulen.
Ein Thema, das ihn besonders bewegt, ist der Schulweg. Viele Zürcher Eltern haben Bedenken, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken, aus Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte. „Ich verstehe diese Ängste“, erklärt er. „Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder zu Beginn begleiten und selbst den Schulweg erleben.“ Gleichzeitig betont er, wie wichtig es sei, dass Kinder den Schulweg selbstständig bewältigen können. Dies sei nicht nur eine Frage der Unabhängigkeit, sondern auch der Sicherheit. Leutenegger erinnert sich an das tragische Unglück am Escher-Wyss-Platz, als ein fünfjähriger Junge auf dem Weg zum Kindergarten überfahren wurde – ein Vorfall, der die Gefahren des Verkehrs besonders deutlich machte.
Die Diskussion über die Privatschule versus die öffentliche Sekundarschule nimmt ebenfalls einen zentralen Platz in Leuteneggers Ansichten ein. Für ihn ist es problematisch, dass in vielen Zürcher Stadtteilen das Gymnasium als der einzig wahre Bildungsweg angesehen wird. „Das Gymnasium wird in vielen Kreisen fast schon als die Königsdisziplin betrachtet, dabei zeigt unser duales Bildungssystem, dass 80 Prozent der Schweizer Jugendlichen eine Lehre machen“, erklärt der Schulvorsteher. Er spricht sich gegen die Idealisierung des Gymnasiums aus, da diese Haltung die Sekundarschule schwächen und die Jugendlichen auf den falschen Weg führen könnte. Die Banken und Versicherungen haben früher ihre Fachkräfte aus der Sekundarschule rekrutiert – heute holen sie auch Abiturienten, was die Bedeutung der Sekundarschule und des beruflichen Bildungssystems unterstreicht.
Die Frage nach der Zukunft des Langzeitgymnasiums stellt sich in Zürich immer wieder. Leutenegger ist der Ansicht, dass das Langzeitgymnasium, obwohl es nicht abgeschafft werden sollte, weniger gefördert werden sollte. Stattdessen plädiert er dafür, das Kurzzeitgymnasium stärker in den Fokus zu rücken. Dies würde den Schülern mehr Zeit geben, sich zu entwickeln und den für sie besten Bildungsweg zu finden. „Wir sollten den Druck aus der Primarschule herausnehmen und den Schülern mehr Zeit lassen“, erklärt er. Die Entscheidung, ob ein Kind das Gymnasium oder die Sekundarschule besuchen sollte, sollte nicht bereits in der fünften Klasse getroffen werden, sondern den Schülern mehr Entscheidungsfreiheit bieten.
Ein weiteres Thema, das den Schulvorsteher beschäftigt, ist die Idee, Schulzimmer in heißen Sommermonaten zu klimatisieren. Die Forderung nach einer klimatisierten Schule wird immer wieder laut, besonders in den oberen Etagen der Neubauten der Stadt Zürich. „Gerade bei über 30 Grad ist es schwer, Kinder im Unterricht zu halten. Es braucht pragmatische Lösungen, wie zum Beispiel die Nutzung von Photovoltaikanlagen, um klimafreundliche Klimaanlagen zu betreiben“, schlägt Leutenegger vor.
Abschließend äußert sich Leutenegger zur Schulpolitik in Zürich. „Die Schulpolitik ist ein Tummelfeld für alle in der Politik“, sagt er. „Das zeigt sich besonders bei den jährlichen Budgetdebatten im Gemeinderat, in denen immer wieder neue Stellen geschaffen werden, in der Hoffnung, den Unterricht zu verbessern. Aber mehr Mittel machen den Unterricht nicht unbedingt besser. Wir müssen uns vielmehr fragen, was den Kindern tatsächlich gut tut.“
Im Hinblick auf seinen baldigen Abschied erklärt Leutenegger: „Ich habe meine Arbeit als Schulvorsteher immer sehr genossen. Es ist eine erfüllende Aufgabe, bei der ich mich um die Kinder, Eltern und das Schulpersonal kümmern konnte. Mein Ziel war es immer, die Freude der Kinder am Lernen zu fördern und sie für das Leben zu motivieren.“ Er betont, wie wichtig es ist, dass die Schüler ihre Neugier behalten und mit Freude an die Schule gehen. In einer Stadt wie Zürich, die den Kindern so viele tolle Möglichkeiten bietet, sei dies eine „sensationelle“ Chance.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht: Teures Baumprojekt in Zürich: Eine teure Show für die Stadtbegrünung
Foto von nzz