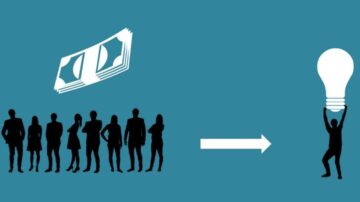Die Schweizer Kryptoszene – oft liebevoll als "Crypto Valley" bezeichnet – ist weltweit bekannt für ihre progressive und zugleich pragmatische Haltung gegenüber digitalen Assets, die als Blaupause für viele andere Nationen dient. Dieses Klima der Innovationsfreundlichkeit ist untrennbar mit einem Höchstmaß an regulatorischer Klarheit verbunden, welche durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) gewährleistet wird. Während anderswo die Gesetzgeber noch mit den Grundlagen der Blockchain-Technologie ringen, hat die Schweiz mit der vollständigen Inkraftsetzung des DLT-Gesetzes (Bundesgesetz zur Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register) am 1. August 2021 als eines der ersten Länder der Welt einen detaillierten und umfassenden Rechtsrahmen für die Tokenisierung und den Handel digitaler Vermögenswerte geschaffen. Dies sorgt für beispiellose Rechtssicherheit in Bereichen wie dem Wertpapierrecht, der Verwahrung kryptobasierter Vermögenswerte und der Lizenzierung von Handelsplätzen. Die FINMA agiert dabei nach dem Prinzip der Technologieneutralität; das heißt, die regulatorischen Pflichten richten sich nach dem wirtschaftlichen Zweck der Aktivität, nicht nach der verwendeten Technologie, wie berichtet nume.ch.
Die FINMA ist damit nicht nur eine Aufsichtsbehörde, sondern auch ein wichtiger Akteur, der durch seine Wegleitungen und Aufsichtsmitteilungen aktiv zur Definition der Spielregeln beiträgt. Diese proaktive Haltung hat die Schweizer Krypto-Industrie in die Lage versetzt, globale Marktturbulenzen und Konkurse, wie sie in anderen Jurisdiktionen zu beobachten waren, vergleichsweise gut zu überstehen. Das Vertrauen in das strenge, aber klare Schweizer Regime zieht weiterhin hochkarätige Unternehmen und Stiftungen nach Zug und Zürich. Aktuelle Herausforderungen stellen jedoch die schnell wachsende Bereiche des Decentralized Finance (DeFi) und der Dezentralen Autonomen Organisationen (DAO) dar, für die die FINMA ihre Prinzipien adaptieren und konkretisieren muss, um die Integrität des Finanzplatzes Schweiz zu sichern.
Das DLT-Gesetz: Die juristische Grundlage für die Token-Ökonomie in der Schweiz
Das Schweizer DLT-Gesetz ist das Herzstück der regulatorischen Klarheit und eine einzigartige Errungenschaft im globalen Rechtsraum. Es passt verschiedene Bundesgesetze an die Entwicklungen der DLT-Technologie an und schafft damit Rechtssicherheit für tokenisierte Vermögenswerte. Kernstück ist die Einführung des Registerwertrechts (Art. 973d OR), das es ermöglicht, Rechte wie Aktien oder Obligationen rechtsverbindlich auf einer DLT-basierten Infrastruktur abzubilden und zu übertragen. Vor der vollständigen Inkraftsetzung dieser Mantelvorlage gab es erhebliche Rechtsunsicherheit, insbesondere bei der Verpfändung oder der Durchsetzung von Eigentumsrechten an digitalen Vermögenswerten.
Die wichtigsten Anpassungen und Innovationen des DLT-Gesetzes:
- Registerwertrechte: Ermöglichen die rechtlich bindende Tokenisierung von Wertpapieren. Dies macht die Schweiz zu einem führenden Standort für Security Token Offerings (STOs).
- DLT-Handelssysteme: Eine neue Bewilligungskategorie im Finanzmarktinfrastrukturrecht wurde geschaffen, die einen flexiblen Rechtsrahmen für neue Formen von Handelsplattformen für DLT-basierte Vermögenswerte bietet.
- Schutz im Konkursfall: Anleger werden besser geschützt, insbesondere im Falle eines Konkurses von Verwahrern kryptobasierter Vermögenswerte (Art. 242a SchKG).
- Verwahrpflichten: Für die Sammelverwahrung kryptobasierter Vermögenswerte ist zwingend eine FINMA-Bewilligung (FinTech- oder Bankbewilligung) erforderlich, was den Anlegerschutz im Bereich der Custody signifikant erhöht.
| Lizenzkategorie (FINMA) | Voraussetzungen und Tätigkeiten | Mindestkapital |
| FinTech-Bewilligung | Annahme von Publikumseinlagen bis zu CHF 100 Mio.; keine Verzinsung. | CHF 100’000 (eingezahlt oder Garantie) |
| Bankenbewilligung | Uneingeschränkte Annahme von Publikumseinlagen. | CHF 10 Mio. |
| DLT-Handelssystem | Betrieb eines multilateralen Handelssystems für DLT-Effekten; hohe Anforderungen an Organisation und Risikomanagement. | Variiert nach Geschäftsmodell |
Die Rolle der FINMA: Stabilisierung des Crypto Valley durch strenge Aufsicht
Die FINMA ist der zentrale Pfeiler, der die Stabilität des Schweizer Krypto-Sektors gewährleistet und dem sogenannten "Crypto Valley" in Zug seine Glaubwürdigkeit verleiht. Die Aufsichtsbehörde verfolgt einen klaren, risikobasierten Ansatz und wendet die bestehenden Finanzmarktgesetze technologieneutral an. Das bedeutet, dass ein Token, der wirtschaftlich einem Wertpapier (Effekten) entspricht, auch als solches reguliert wird, unabhängig davon, auf welcher Blockchain er ausgegeben wurde. Dies schuf bereits früh Klarheit, insbesondere während des ICO-Booms, als die FINMA Initial Coin Offerings (ICOs) in drei Hauptkategorien unterteilte (Payment, Utility, Asset Token).
Aktuelle Herausforderungen für die FINMA:
- Stablecoins: Die FINMA hat ihre Praxis zu Stablecoins durch die Aufsichtsmitteilung 06/2024 konkretisiert. Sie stellt hohe Anforderungen an die Ausfallgarantien von Banken, die als Garantiegeber für Stablecoins fungieren, und präzisiert die Sorgfaltspflichten zur Geldwäschereibekämpfung (GwG).
- "Travel Rule": Die FINMA verlangt von Blockchain-Dienstleistern (VASPs – Virtual Asset Service Providers) die Einhaltung der globalen FATF-Standards, insbesondere der "Travel Rule", bei Transaktionen über einem bestimmten Schwellenwert. Dies umfasst die Übermittlung von Informationen über Auftraggeber und Begünstigten.
- DeFi/DAO: Bei Dezentralisierten Finanzen (DeFi) und Dezentralen Autonomen Organisationen (DAO) gilt die wirtschaftliche Betrachtungsweise: Wenn eine DeFi-Anwendung wirtschaftlich eine bewilligungspflichtige Tätigkeit (z.B. Bankgeschäft) anbietet, geht die FINMA von einer Bewilligungspflicht aus.
Die Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen (GwG) ist für alle Krypto-Finanzintermediäre von zentraler Bedeutung. Krypto-Dienstleister müssen die Identität ihrer Kunden (KYC) feststellen und Transaktionen risikobasiert überwachen. Die FINMA hat in der Vergangenheit klargestellt, dass die Anonymität von Blockchain-Transaktionen keine Ausnahme von diesen Pflichten darstellt. Dies beinhaltet auch die Verpflichtung, bei der grenzüberschreitenden Übermittlung kryptobasierter Vermögenswerte die erforderlichen Absender- und Empfängerinformationen zu sichern. Diese Haltung unterscheidet die Schweiz von einigen weniger streng regulierten Jurisdiktionen und stärkt ihren Ruf als sicherer Hafen.
Die Herausforderung von DeFi und DAO: Die Grenzen der Dezentralisierung
Die regulatorische Landschaft wird durch die schnelle Entwicklung von DeFi und DAO ständig neu definiert. Dezentrale Finanzanwendungen basieren auf automatisierten Smart Contracts, die theoretisch ohne menschliches Zutun oder zentrale Kontrolle funktionieren sollen. Für die FINMA stellt sich hier die kritische Frage: Wer trägt die Verantwortung und wer benötigt eine Bewilligung, wenn es keine zentrale Organisation gibt? Das Prinzip der Technologieneutralität ist hier besonders gefordert.
Details zur regulatorischen Einordnung von DAO und DeFi-Protokollen:
- Wirtschaftliche Betrachtungsweise: Die FINMA ignoriert die technische Dezentralisierung nicht, betrachtet aber den wirtschaftlichen Zweck. Bietet ein DeFi-Protokoll faktisch einen Kredit (Depositenannahme) oder einen Handelsservice (DLT-Handelssystem) an, könnte eine Bewilligungspflicht bestehen.
- Governance-Token: Die Rolle der Governance-Token-Inhaber (die über die Entwicklung des Protokolls abstimmen) wird intensiv diskutiert. Werden diese Inhaber rechtlich als Eigentümer oder Organe der DAO betrachtet, könnten sie unter Umständen finanzmarktrechtliche Pflichten erben.
- Oracles und Custodians: Die DeFi-Zusatzdienste (wie DLT Oracles zur Datenlieferung oder Krypto-Verwahrer) spielen eine wichtige Rolle und müssen ebenfalls ihre regulatorische Klassifizierung klären, da sie oft zentrale Kontrollpunkte darstellen.
- Anlegerschutz: Die FINMA warnt aktiv vor den Risiken in unregulierten DeFi-Protokollen, da hier der Schutz im Falle von Hackerangriffen oder Smart-Contract-Fehlern im Vergleich zum regulierten Sektor gering ist.
Die Komplexität liegt darin, dass der Grad der Dezentralisierung fließend ist. Viele DAOs haben immer noch einen Kern von Gründern oder Schlüsselhaltern (Control Keys), die wesentliche Änderungen am Protokoll vornehmen können. Solange diese zentralen Akteure existieren, können sie auch in die regulatorische Verantwortung gezogen werden. Die Schaffung eines klaren Rechtsrahmens für die juristische Persönlichkeit von DAOs (z.B. als Verein oder Stiftung) ist daher der nächste entscheidende Schritt in der Schweiz, um die Stabilität und den Anlegerschutz in diesem innovativen Segment zu gewährleisten.
Transparenz und Konformität: Besteuerung von Kryptowährungen in der Schweiz
Die klare Haltung des Schweizer Staates erstreckt sich auch auf die Besteuerung von Kryptowährungen, was einen weiteren Wettbewerbsvorteil des Standorts darstellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, in denen die Regeln unklar sind, hat die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) in Zusammenarbeit mit den Kantonen detaillierte Richtlinien veröffentlicht, die eine hohe Transparenz garantieren. Diese steuerliche Klarheit ist entscheidend für Unternehmen und Privatpersonen, die legal im Krypto-Sektor tätig sein wollen. Die Besteuerung ist nicht zentral, sondern kantonal geregelt, folgt aber den Grundsätzen der ESTV.

Wesentliche Fakten zur Besteuerung von Krypto-Assets in der Schweiz:
- Vermögenssteuer: Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether gelten als Vermögen und unterliegen der kantonal geregelten Vermögenssteuer. Sie müssen am Ende der Steuerperiode zum Verkehrswert deklariert werden (Jahresschlusskurs).
- Einkommenssteuer (Privatvermögen): Kursgewinne und Kursverluste aus dem Handel mit Kryptowährungen, die im Privatvermögen gehalten werden, sind in der Regel steuerfrei (keine Kapitalertragssteuer).
- Professioneller Handel: Wer gewerbsmäßig mit Kryptowährungen handelt (als sogenannter professioneller Händler oder Unternehmer), muss die Gewinne als Einkommen oder Ertrag versteuern (Einkommenssteuer oder Körperschaftsteuer).
- Staking und Mining: Erträge aus Mining oder Staking werden in der Regel als steuerbares Einkommen betrachtet, da sie als "Lohn" für eine erbrachte Leistung gelten.
| Besteuerter Krypto-Vorgang | Steuerart | Anmerkungen |
| Haltung von Bitcoin/Ether | Vermögenssteuer | Jährliche Deklaration zum Jahresschlusskurs der ESTV. |
| Kursgewinne (Privathandel) | In der Regel steuerfrei | Ausnahme: Qualifikation als gewerbsmäßiger Händler. |
| Mining- oder Staking-Erträge | Einkommenssteuer | Wird als Ertrag aus Tätigkeit gewertet. |
| Verkauf von NFT | Einkommenssteuer oder Privatgewinn | Abhängig von der Qualifikation als Kunstwerk, Recht oder Anlage. |
| Körperschaftsteuer (Unternehmen) | Proportionaler Satz | Kantonal geregelt (z.B. Zug ca. 11,9%–15,1% effektiv). |
Die schweizerische Steuerlandschaft zeichnet sich durch ihre attraktiven Sätze aus, insbesondere im Kanton Zug (Sitz des Crypto Valley). Die Körperschaftsteuer liegt dort im internationalen Vergleich sehr niedrig, und die Möglichkeit, Steuern in Kryptowährung zu bezahlen (angeboten in Zug und einigen anderen Gemeinden), unterstreicht die Krypto-Freundlichkeit des Standorts. Die klare Unterscheidung zwischen privatem (steuerfreiem) und professionellem Handel ist ein wichtiger Anreiz für Privatpersonen, sich legal im Krypto-Sektor zu engagieren, während die strengen Compliance-Anforderungen des Finanzmarktes die Integrität des gesamten Ökosystems sicherstellen.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht – in der Schweiz und der Welt: CBDC Schweiz – Digitaler Franken, Pilotprojekte und Bankenintegration