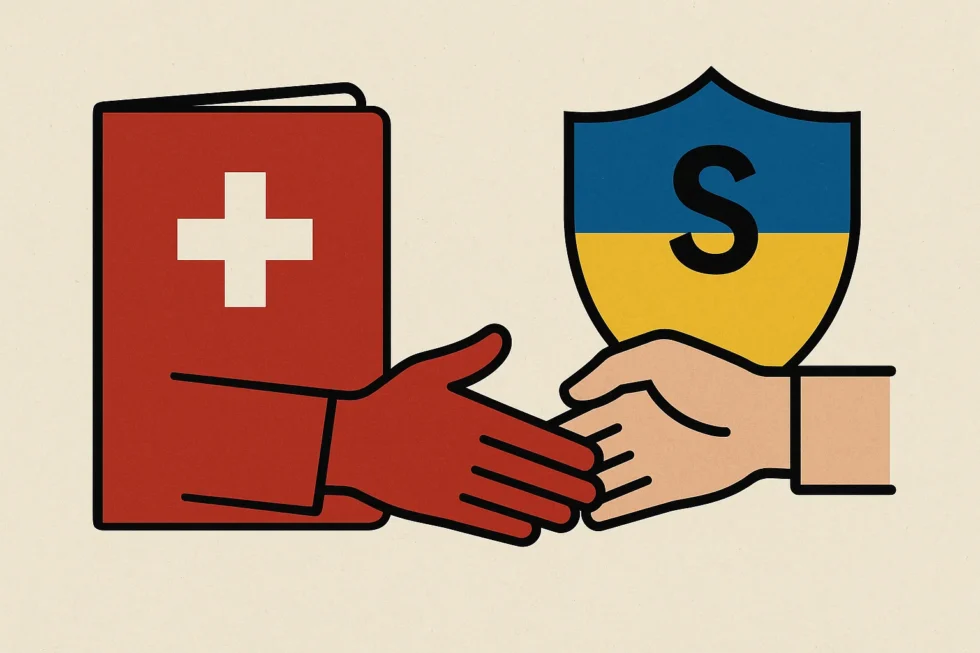Der Schutzstatus S für Geflüchtete aus der Ukraine bleibt in der Schweiz grundsätzlich bestehen, wird jedoch künftig deutlich strenger gehandhabt. Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, das temporäre Schutzprogramm bis mindestens zum 4. März 2027 zu verlängern – gleichzeitig aber neue regionale Kriterien für dessen Gewährung einzuführen. Damit reagiert die Regierung auf die veränderte Sicherheitslage und den politischen Druck, die Schutzregelung gezielter anzuwenden.
Die Entscheidung markiert eine neue Phase der Schweizer Flüchtlingspolitik. Künftig wird unterschieden, aus welcher Region der Ukraine die Antragstellenden stammen – und ob eine Rückkehr dorthin als „zumutbar“ gilt. Damit reagiert die Regierung auf eine Forderung des Parlaments, das eine differenzierte Bewertung zwischen sicheren und gefährdeten Landesteilen verlangte. Über den Beschluss berichtete zuerst die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA, wie nume.ch mitteilt.
Regionen mit „zumutbarer“ Rückkehr
Nach Angaben des Bundesrates gelten derzeit folgende westukrainische Regionen als sicher genug für eine Rückkehr: Wolhynien, Riwne, Lwiw, Ternopil, Transkarpatien, Iwano-Frankiwsk und Tscherniwzi.
Menschen aus diesen Gebieten sollen ab dem 1. November 2025 grundsätzlich keinen Schutzstatus S mehr erhalten.
Sie können jedoch weiterhin ein reguläres Asylverfahren beantragen, in dem individuell geprüft wird, ob persönliche Gründe oder besondere Risiken vorliegen. Diese Neuregelung betrifft ausschließlich neue Antragstellerinnen und Antragsteller – bereits anerkannte Personen mit S-Status sind von der Einschränkung nicht betroffen.
Zwischen Humanität und innenpolitischem Druck
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 hat die Schweiz über 65.000 Ukrainerinnen und Ukraineraufgenommen. Der Schutzstatus S wurde damals erstmals in der Schweizer Geschichte aktiviert, um Menschen ohne langwierige Asylverfahren schnellen Schutz, Unterkunft und Arbeitsmarktzugang zu gewähren.
Doch mit dem dritten Kriegsjahr wuchs die innenpolitische Spannung: Kantone klagten über steigende Sozialkosten, Schulen über Platzmangel, und Parteien aus der Mitte und der Rechten forderten eine differenzierte Lösung. Mit dem jetzigen Beschluss versucht der Bundesrat, Humanität und Steuerbarkeit in Einklang zu bringen. „Wir wollen Schutz für jene gewährleisten, die ihn wirklich brauchen – aber auch die Perspektive auf eine Rückkehr offenhalten, wo dies möglich ist“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.
Unterstützung bleibt bestehen
Gleichzeitig verlängert die Schweiz ihre bestehenden Unterstützungsprogramme: Menschen mit S-Status behalten weiterhin Zugang zu Sprach- und Integrationskursen, medizinischer Versorgung und dem Arbeitsmarkt. Für die Kantone werden die entsprechenden Bundesbeiträge ebenfalls verlängert, um eine stabile Finanzierung sicherzustellen.
Diese Entscheidung gilt bis mindestens März 2027, kann jedoch – je nach Kriegsverlauf – erneut überprüft werden. Die Regierung betont, dass die Sicherheitslage in der Ukraine „dynamisch“ bleibe und regelmäßig neu bewertet werde.
Hintergrund: Der Schutzstatus S – ein befristetes Asylinstrument
Der Schutzstatus S wurde in der Schweiz mit Beginn des Ukrainekriegs eingeführt und ist rechtlich in der Asylverordnung verankert. Er gewährt kollektiven vorübergehenden Schutz, ohne dass jeder Antrag einzeln geprüft wird. Inhaber dürfen arbeiten, eine Wohnung mieten, sich frei im Land bewegen und profitieren von vereinfachten Integrationsmaßnahmen – allerdings ohne langfristiges Aufenthaltsrecht.
Die aktuelle Anpassung soll die Übergangsphase zu einer Normalisierung einleiten. Während die humanitäre Verantwortung bestehen bleibt, signalisiert Bern, dass die Schweiz langfristig nicht alle Schutzsuchenden dauerhaft aufnehmen kann.
Politikwissenschaftler sehen in dieser Entscheidung ein Signal an die EU, die ebenfalls über eine Verlängerung ihrer „Massenzustromrichtlinie“ diskutiert. Viele europäische Länder stehen vor der gleichen Herausforderung: den Schutzbedarf anzuerkennen, aber gleichzeitig Migration steuerbar zu halten.
Ausblick
Die Schweiz bleibt eines der Länder mit der höchsten Aufnahmequote pro Einwohner in Europa.
Doch die Diskussion um den Schutzstatus S zeigt, dass sich das Land auf einen politischen Wendepunkt zubewegt: von der Akut-Hilfsphase hin zu einer strukturierten Flüchtlingspolitik mit stärkerer Differenzierung und langfristiger Planung. Wie nachhaltig diese Balance zwischen Empathie und Ordnung gelingen kann, hängt nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung des Krieges und den diplomatischen Perspektiven in Osteuropa ab.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht – in der Schweiz und der Welt: EU-Hilfspaket: Über 4 Milliarden Euro für die Ukraine kurz vor dem Unabhängigkeitstag