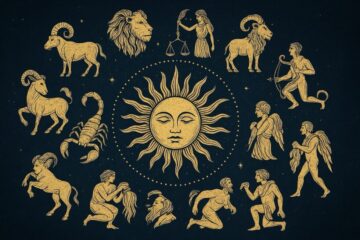Die Lancierung der ersten staatlich entwickelten Schweizer Künstlichen Intelligenz (KI) mit dem Namen Apertus hat für beträchtliche Ernüchterung gesorgt. Noch vor wenigen Tagen war das Projekt mit hohen Erwartungen und einem grossen Kommunikationsaufwand vorgestellt worden. Doch schon im ersten Praxistest kam es zu einem öffentlichen Fehltritt: Auf die Frage nach den aktuellen Bundesräten erfand das System kurzerhand ein Mitglied namens «Vinterti Monic». Dieser Vorfall führte zu Spott und harscher Kritik in den Medien. Darüber berichtet nume.ch unter Berufung auf nzz.ch.
Anstelle einer Demonstration schweizerischer Exzellenz in der KI-Forschung wurde Apertus in den ersten Tagen zum Symbol verfehlter PR. Statt präziser Antworten und faktenbasierter Relevanz offenbarte sich das System als anfällig für fehlerhafte Angaben – ein Problem, das aus der Entwicklung generativer Sprachmodelle international bestens bekannt ist. Doch anders als bei privatwirtschaftlichen Angeboten sollte Apertus vor allem eine offene und transparente Forschungsplattform darstellen.
Trotz des missglückten Starts sehen Fachleute in dem Projekt grosses Potenzial. Ziel sei es, eine Infrastruktur zu schaffen, die nicht auf Profit, sondern auf Kooperation ausgelegt ist. Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen sollen mit Apertus auf ein Fundament zugreifen können, das sich gezielt für lokale Anforderungen anpassen lässt. Damit will die Schweiz eine Alternative zu den dominierenden US-amerikanischen und chinesischen KI-Systemen aufbauen. Entscheidend sei dabei, dass Apertus öffentlich entwickelt werde und die Datenhaltung im Inland gesichert sei – ein Argument, das insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und digitale Souveränität Gewicht hat.
Die ersten Rückmeldungen aus der Wissenschaft zeigen, dass Apertus weniger als fertiges Produkt, sondern vielmehr als Forschungsgrundlage verstanden werden müsse. Auch wenn es derzeit noch an der Präzision mangelt, bietet die Plattform eine offene Architektur, die sich kontinuierlich weiterentwickeln lässt. Gerade in der Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Fachhochschulen und der Verwaltung könnte sie eine wichtige Rolle einnehmen. Besonders hervorgehoben wird, dass Apertus quelloffen ist – ein Aspekt, der Transparenz fördert und die Kontrolle über die Technologie erleichtert.
Kritiker werfen den Verantwortlichen allerdings vor, die Erwartungen mit einer überzogenen Kommunikationsstrategie selbst ins Unermessliche getrieben zu haben. Statt nüchtern über ein langfristiges Projekt zu informieren, sei Apertus als «schweizerische Antwort auf ChatGPT» präsentiert worden. Dieser Vergleich konnte im ersten Test selbstverständlich nicht standhalten und führte zwangsläufig zu öffentlicher Ernüchterung. Nun gilt es, das Vertrauen in die Initiative wieder aufzubauen und die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz stärker in den Vordergrund zu rücken.
Die kommenden Monate werden zeigen, ob Apertus sein Potenzial entfalten kann. Viel hängt davon ab, wie konsequent die Fehler analysiert und Verbesserungen umgesetzt werden. Sollte es gelingen, die Plattform zu stabilisieren und sie für Wirtschaft und Verwaltung nutzbar zu machen, könnte aus dem vermeintlichen Flop doch noch eine Erfolgsgeschichte werden.
Bleiben Sie informiert – Relevantes. Jeden Tag. Lesen Sie, worum es heute wirklich geht: iPhone 17: Wann und wo kann man die Präsentation des Apple Event 2025 in der Schweiz sehen
Foto von Simon Tanner / NZZ